Mine im Interview
Musik, die kleben bleibt
Foto: Simon Hegenberg
Mine im Interview
Mine kombiniert Folk mit Hip-Hop und Jazz und nimmt uns in ihren Songs mittenrein in ihre Seele. Für die Liebe zur Musik hat die Sängerin sogar ihren Masterabschluss „geopfert“.
Mine, dein aktuelles Album heißt „Klebstoff“. Was verbindest du mit diesem Wort?
Ich finde es auf vielen Ebenen interessant. Zum einen phonetisch – es hat einfach eine schöne Aussprache. Zum anderen steht es für mich symbolisch für das, was man ist und wo alles herkommt. Also alles, was im Leben an einem haften bleibt.
Du hast einen Bachelor in Jazzgesang und einen Master in Producing und Composing fast beendet. Was ist aus dieser Zeit an dir „kleben geblieben“?
Einer der wichtigsten Momente war für mich, dass ich überhaupt angenommen wurde. Weil ich noch sehr unsicher war und nicht wusste, ob diese Lust an der Musik allein überhaupt reicht, um das als Beruf zu machen. Hätte es damals nicht geklappt – ich glaube, ich wäre nicht Musikerin geworden. Ich hätte es mir nicht zugetraut.
Wenn du an deine Studienzeit zurückdenkst: Was war das Tollste, was das Schlimmste?
Also das Schlimmste war der sehr hohe Leistungsdruck. Ich musste zum Beispiel mal in einer Art Prüfung vor der Klasse scatten. Ich war da voll schlecht drin, hatte schreckliches Lampenfieber und habe keinen Ton rausbekommen. Es war wie im Film, alle haben mich angeschaut. Danach bin ich erstmal weinend rausgerannt. Das Tollste war dann aber zu erkennen, dass ich das Studium so nutzen kann, wie ich es will. Dass Musik eben kein Sport ist und man nicht die Beste in allem sein muss. Das war für mich eine wichtigere Erkenntnisse als Fragen wie: Was klingt gut bei Fis-Moll?
Dein Masterstudium an der Popakademie Mannheim hast du dann aber abgebrochen. Woran lag’s?
Das war sehr schlimm für mich, weil es das erste Mal war, dass ich was abgebrochen habe. Doch damals gab es schon das Mine-Projekt mit Tour und Videodrehs. Und um das zu finanzieren, hatte ich drei Jobs und kaum Zeit für die Masterarbeit. Ich haben sie trotzdem geschrieben – in zwei Wochen. Natürlich war die grottenschlecht und ich bin durchgefallen. Die Dozenten haben mir zwar eine zweite Chance gegeben, aber ich habe mich letztendlich gegen den Abschluss entschieden.
Hast du es je bereut?
Nein, hab ich nicht. Natürlich ist da manchmal noch dieses Bauchgefühl: Mist, ich habe abgebrochen. Vor allem, weil ich ja alles fertig hatte, alle Scheine, auch die Masterarbeit. Ich bin nur den letzten Schritt nicht gegangen. Vielleicht hole ich es irgendwann nach. Wenn ich mal paar Wochen krank bin und keine Musik machen kann.
Was hat deine Familie zum Thema Musikkarriere gesagt?
Da gab es viele Bedenken. Ich bin auch sehr früh ausgezogen, weil es so schwierig war. Ich glaube, mein Vater hätte gern gesehen, wenn ich seine Firma für Schalttechnik übernommen hätte. Aber ich wusste schon früh, dass ich keinesfalls einen Job machen will, der mir meine Zeit stiehlt, so krass das auch klingt. Ich will immer irgendwas machen, was mich erfüllt.
Deine Songs wirken oft fast wie Tagebucheinträge. Ist Songschreiben für dich eine Art alternativer Psychologe?
Auf jeden Fall. Ich hatte immer schon Schwierigkeiten, mit Leuten über meine Probleme zu reden. Zwar ist das schon besser geworden, aber auch heute noch packe ich das alles lieber in meine Songs. Die sind ein Ventil für mich. Meistens schreibe ich kurz nach einer Phase, in der es mir schlecht ging. Wenn es einem nicht gut geht, setzt man sich mit Dingen auseinander, die einem sehr nahe sind und kommt dann oft zu krassen Erkenntnissen.
Wer oder was inspiriert dich zu deinen Songs?
Alles eigentlich. Musik anderer Künstler natürlich, aber auch meine Freunde, mein Umfeld und das, was politisch gerade los ist. Ich finde es sehr krass, was momentan passiert. Ich dachte, die Vergangenheit wäre uns eine große Lehre gewesen. Und jetzt den rechten Sektor so erstarken zu sehen, das ist für mich total absurd, lässt mich fassungslos zurück und macht emotional sehr viel mit mir. Ich will und muss dann auch darüberschreiben.
2017 hat #MeToo die Filmbranche und ein bisschen auch den Politikbetrieb und die „normale“ Arbeitswelt zum Beben gebracht. Aus dem Musikbusiness hingegen hat man dazu kaum etwas vernommen. Läuft dort alles korrekt?
Es geht nicht mehr und nicht weniger geschlechterungerecht zu wie in anderen Bereichen auch. Warum sich aus der Musikszene niemand zu Wort gemeldet hat, kann ich gar nicht sagen. In meinem Umfeld wird aber sehr viel darüber gesprochen. Keine Missbrauchsfälle zwar, aber Ungleichheit im Allgemeinen. Zum Beispiel als neulich die Studie rauskam, dass Männer bei Warner viel mehr verdienen als Frauen. Auch die Lineups bei Festivals sind ein Thema. Dieses Jahr gab es in der Nähe von München das erste Festival mit 50 Prozent männlichen und 50 Prozent weiblichen Acts. Das ist ein sehr großer Schritt, finde ich. Weil man sonst eher ein Verhältnis 20 zu 80 Prozent hat. Es tut sich was, aber noch immer herrscht klar das Patriarchat. In der Gema sitzen zum Beispiel fast nur weiße Männer über 50.
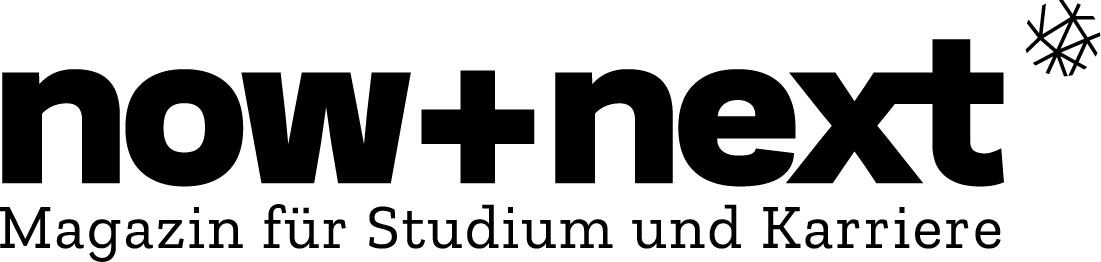










Rund 30 bis 50 Prozent der Menschen sind introvertiert, also eher ruhig und zurückhaltend. Auch Melina Royer gehört dazu. Früher arbeitete die 36-Jährige als Creative Director – und hatte oft mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Heute hilft sie anderen leisen Menschen in der lauten Business-Welt: Mit ihrem Partner Timon betreibt Melina den Blog „Vanilla Mind“, bietet Coachings an und hostet den Podcast „Still & Stark“. Im Interview spricht sie über ihre eigene Introvertiertheit und wie man diese für die Karriere nutzen kann.