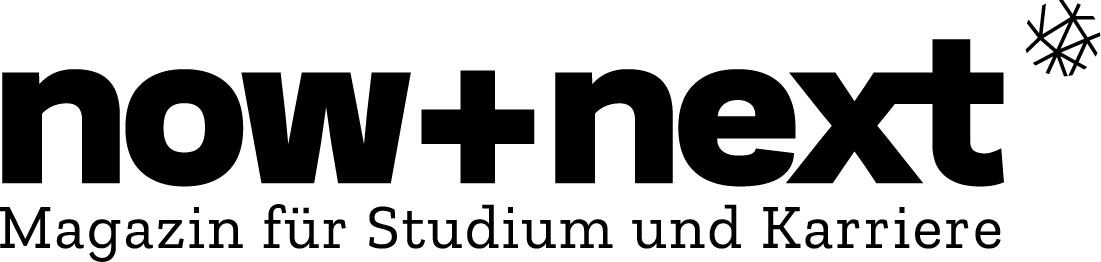Studieren mit HIV
Nur eine Pille täglich
Gerade mal so viel braucht Max (l.), um seine HIV-Infektion im Griff zu haben.
Foto: Christian Denke
Studieren mit HIV
HIV ist heute eine Infektion, mit der Betroffene dank des medizinischen Fortschritts gut leben können. Die Gesellschaft hat sich weniger schnell entwickelt: HIV-Positive erleben häufig Diskriminierung, auch im Uni-Umfeld.
Luca* hat angefangen zu heulen, als ihm seine Ärztin mitgeteilt hat, dass er HIV-positiv ist. Er sei in eine Schockstarre gefallen, die knapp einen Monat gedauert habe, sagt der heute 24-Jährige. „Ein Tunnelblick, als würde meine Wahrnehmung der Umgebung nachlassen“, so hat er sich damals, im Sommer 2018, gefühlt. Der Grund: Unwissenheit. Er hatte kein
realistisches Bild einer HIV-Infektion. Nach einem Besuch bei einem Immunologen hat sich das grundlegend verändert: „Ich hätte nicht gedacht, dass das heute möglich ist.“ Dass HIV-Positive bei einer erfolgreichen Therapie niemanden mehr anstecken können. Dass sie eine normale Lebenserwartung haben. Dass sie nur eine Tablette täglich nehmen müssen. Außerdem kam Luca kurz nach seiner Infektion mit einem anderen HIV-Positiven zusammen. Sein Freund war ein bisschen älter, erfolgreich im Beruf. „Da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass man mit dieser Infektion ganz normal leben kann.“
(c) Fabian Schäfer
Der medizinische Fortschritt in den letzten Jahrzehnten ist enorm. Die Gesellschaft jedoch hat sich nicht im selben Tempo mitentwickelt. Mehr als unter den gesundheitlichen Folgen leiden HIV-Positive unter Diskriminierung. So auch Luca, der das in einer Zahnklinik erlebt hat: Der
Biologie-Student durfte nur in einem bestimmten Raum behandelt werden – das war oft mit langen Wartezeiten verbunden. Die Ärzte haben nicht ihre normale Schutzkleidung getragen, sondern waren „komplett in Plastik eingewickelt, wie auf einer Quarantänestation“, sagt Luca. „Das hat mir das Bild vermittelt, selbst mein Speichel sei hochansteckend. Medizinisch ist das völliger Schwachsinn.“
Nicht ansteckend - und trotzdem gebrandmarkt
Auf seiner Patientenakte war ein riesiges rotes S gemalt. „Das steht für hochansteckend. Jeder kann das sehen. Ich habe mehrmals darum
gebeten, das zu entfernen. Meine Virenlast ist unter der Nachweisgrenze.“ Das heißt, dass HI-Viren in Lucas Blut dank der Therapie nicht mehr nachgewiesen werden können. Er kann niemanden anstecken. „Das erste S war auch durchgestrichen, aber nach ein paar Monaten wurde wieder eins drauf gemalt“, erzählt der Student. „Ich habe mich damit abgefunden. Irgendwann war es mir zu blöd.“
Für Ute Krackow gehören solche Erfahrungen zum Alltag. Seit fast 30 Jahren ist sie Sozialarbeiterin bei der Aidshilfe Kiel. Sie erzählt von zwei Fällen, die sie über die anonyme Online-Beratung erreicht haben: Zwei
HIV-positive Medizinstudenten sollten einen HIV-Test machen, ehe sie zu
bestimmten praktischen Modulen zugelassen werden. Die Angst, dass ihre
Infektion entdeckt wird, war riesig. „Das war wirklich ganz, ganz schwierig. Es ist furchtbar, dass ambitionierten jungen Menschen solche Steine in den Weg gelegt werden.“
Ob Unis von Medizinstudierenden überhaupt HIV-Tests verlangen dürfen, ist laut Ute Krackow unsicher. Immerhin dürfen HIV-Positive laut einer Empfehlung der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Virus- krankheiten und der Gesellschaft für Virologie sogar als Chirurg arbeiten. Einer der beiden Studenten hat sich später noch einmal an Ute Krackow gewandt. Er habe sich „irgendwie durchgewurschtelt und später die Uni gewechselt.“ Vom anderen hat sie nichts mehr gehört.
Rausgeschmissen wegen HIV
Doch nicht nur – ausgerechnet – im medizinischen Bereich erleben HIV-Positive Diskriminierungen. Robert, 26, der in Mainz Geisteswissenschaften studiert, wurde einmal bei einer Studentenverbindungsparty rausgeschmissen, weil er HIV hat. Dort ging irgendwann nachts das Gespräch um Krankheiten und Therapien und er erzählte von seiner HIV-Infektion. „Einer kam dann und hat mich rausgeworfen. Ich soll hier niemanden in Gefahr bringen, hat er gesagt“, erinnert sich Robert an den Vorfall, der kurz nach seinem positiven Testergebnis vor zweieinhalb Jahren passiert ist. „Meine Freunde standen mir bei, aber er hat halt das Hausrecht. Das tat sehr, sehr weh. Eine halbe Stunde war ich total betroffen, dann habe ich’s vergessen. Ich fresse so etwas nicht in mich rein.“
Als er nach dem Blutspenden das positive Testergebnis bekam, machte er sich selbst zwei Stunden lang Vorwürfe. „Dann habe ich mich darauf
eingelassen und die Info verarbeitet. Ich bin seit Jahren mit Positiven
befreundet, ich weiß, was HIV heute heißt. Einmal am Tag eine blöde Tablette nehmen.“
Sein Umfeld reagierte sehr verständnisvoll, Freunde verhalten sich nicht anders. Auch bei seinem Gastro-Job gab es keine Probleme. „Ich erlebe auch oft, dass Freunde dann Fragen stellen, weil sie wenig über HIV
wissen.“ Ihm ist wichtig, dann ein realistisches Bild der Infektion zu
vermitteln. „Sie macht mein Leben nicht schlechter. Ich bin derselbe Mensch.“
Max spielt kein Versteckspiel
Genau aus diesem Grund machte auch Max, 23, seine HIV-Infektion öffentlich. 2016 gab er dbna, einer Online-Community für queere
Jungs, ein Interview dazu. Es folgten Projekte für die Aidshilfe, 2017 ein
Videointerview mit bento, dem jungen Magazin von Der Spiegel. Er hat darauf viel Zuspruch erhalten, vielen hat er die Angst vor einem Test genommen.
Max hat Pharmazie studiert. Gerade absolviert er den ersten Teil seines Praktischen Jahres in der Krankenhausapotheke der Uniklinik Erlangen. Beim Betriebsarzt hat er seine Infektion angegeben, auch wenn er das
nicht hätte machen müssen. Der Arzt ist dann, so Max‘ subjektiver Eindruck,
„sehr genau geworden.“ Er wollte die Daten über seine Viruslast nicht nur bis 2017, sondern bis heute. „Er hat mich belehrt, dass ich mich nicht stechen und nicht in Medikamentenbeutel bluten darf. Die Belehrung sollte ich auch unterschreiben.“ Der 23-Jährige fand das „interessant bis lustig. Natürlich blute ich nirgendwo rein. Das würde ich auch nicht machen, wenn ich HIV-negativ wäre. Die Situation war merkwürdig, aber ich kann es auch verstehen.“
Dass er durch seinen öffentlichen Umgang mit HIV berufliche Nachteile haben könnte, schließt Max aus. Er ist wie alle HIV-Positiven durch das Antidiskriminierungsgesetz geschützt. „Und wenn ein Arbeitgeber mich
diskriminieren sollte, dann gibt es ein Problem mit ihm. Dann will ich dort
auch nicht arbeiten.“
*Name von der Redaktion geändert.